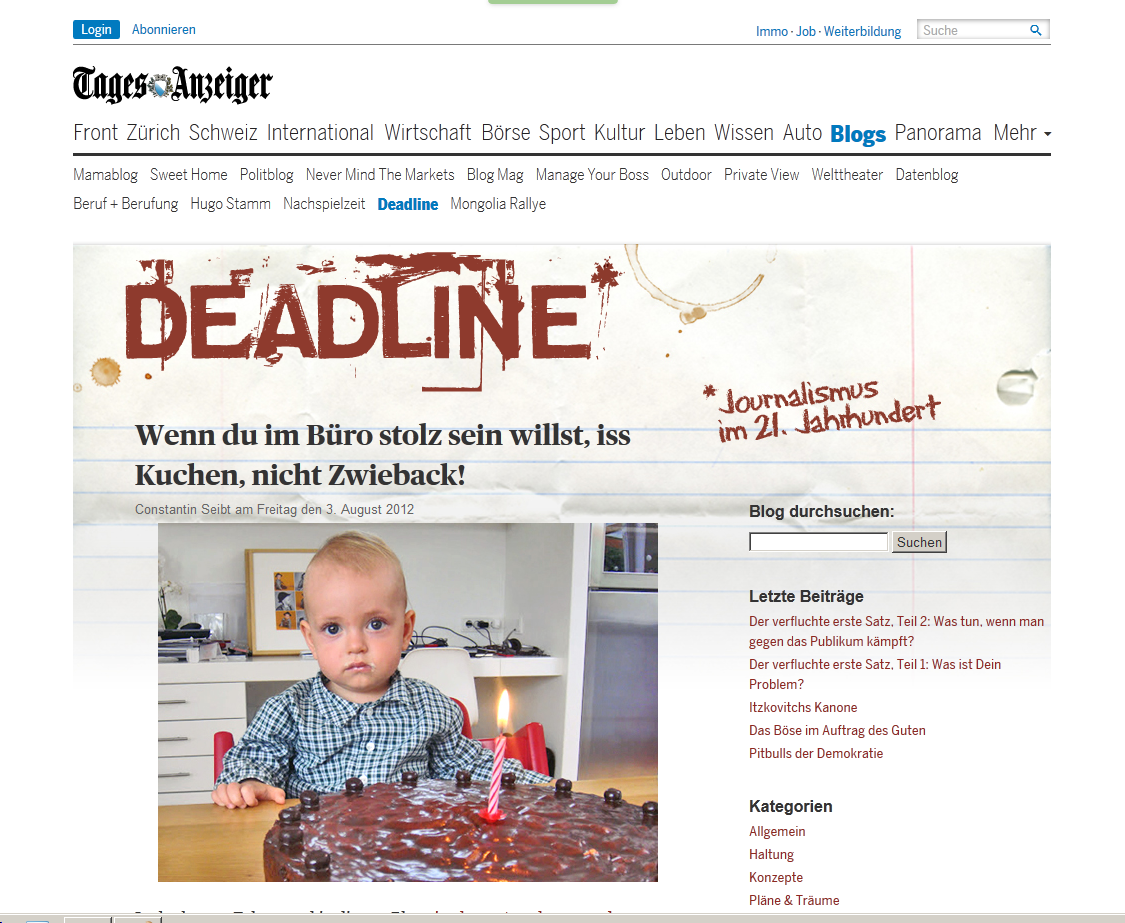Auch Textjournalisten sollten in Bildern denken (können)
Das Kopfkino in Gang setzen

Fotos, Zeichnungen und Karikaturen sind genau wie Infografiken oder datenbasierte, interaktive Apps wesentlich mehr als dekoratives Beiwerk zum „richtigen“ Journalismus. Sie sind im besten Fall selbst genau das: echter Journalismus, der seinen Punkt auch ohne viele erklärende Worte deutlich macht. Wenn beides zusammenkommt – ein guter Text und eine ausdrucksstarke Visualisierung – dann entstehen daraus Geschichten mit Mehrwert.
Der miese Enkeltrick
Die meisten Bild- und Videojournalisten wissen das intuitiv. Oder sie haben es während ihrer Ausbildung oder spätestens in den ersten Jahren ihrer Berufstätigkeit gelernt. Weniger verbreitet ist diese Erkenntnis immer noch in der schreibenden Zunft. Dass visuelles Denken dort nicht jedem liegt, zeigen die „schönsten“ Beispiele von Text-Bild-Scheren, die im Netz kursieren. Da wird das Bild eines Schulkinds mit seinen Großeltern just über einer Schlagzeile platziert, die vor dem „Enkeltrick“ warnt.
Natürlich gibt es auch Textmenschen mit einem ausgeprägten Sinn für das Visuelle. Für einige gehört das zum Beruf: Wer fürs Fernsehen arbeitet, muss sich immer auch mit der Bebilderung seiner Geschichte auseinandersetzen – ob in Absprache mit den Kameraleuten oder in Eigenregie mit der Digicam auf der Schulter. Und wenn man Foto- oder Filmaufträge an Freie erteilt, sollte man schon wissen, welche Motive eine Story braucht – und was machbar ist.
„Machbarkeit“ betrifft dabei mehr als die technische Seite: Welchen Aufwand müssen die Bildkollegen für ein bestimmtes Motiv betreiben? Lässt sich überhaupt umsetzen, was sich der Aufttraggeber am Redaktionsschreibtisch vorstellt? Oder stehen Zeit, Umgebung, die Protagonisten und andere Bedingungen dagegen?
Zugleich sind in vielen Medienhäusern die Grenzen zwischen Text- und Bildmachern längst aufgeweicht: Der Seitenumbruch gehört heute für viele Printredakteure zum Alltag wie auch das Online-Stellen von Beiträgen, die mit Fotostrecken, Audio-Slideshows und Filmclips verknüpft werden.
Neue Erzählformen wie Visual Journalism oder Digital Storytelling entstehen (siehe Kasten „Storytelling“). Begünstigt wird das durch technische Entwicklungen wie die Software Pageflow: Das Open-Source-Tool, das der WDR kostenlos zur Verfügung stellt, verbindet bildschirmfüllende Bilder oder Videos mit Texten und Audios. So lassen sich Multimediareportagen auch ohne Programmierkenntnisse zusammenzustellen. Das Arbeiten damit mag Bild-, Fernseh- oder Hörfunkjournalisten leichter fallen, soll sich aber wie ein „Mini-CMS“ auch Wortjournalisten erschließen und ist nach WDR-Angaben „intuitiv zu bedienen“.
Keine Entwarnung für Textkollegen
Und wer so gar keine Multimedia-Ambitionen hat, wer wirklich einfach „nur“ Texte schreibt? Sorry, keine Entwarnung. Auch diese Kolleginnen und Kollegen müssen sich mit dem Thema „in Bildern denken“ auseinandersetzen. Das gibt es nämlich auch in der Textvariante. So wie der Betrachter aus Fotos eine ganze Geschichte herauslesen möchte, will er beim Lesen Bilder vor seinem inneren Auge vorbeiziehen sehen. Denn Bilder sind das, was Fakten verständlich und abstrakte Sachverhalte lebendig werden lässt, was Gefühle vermittelt und Nähe erzeugt. Also: was Geschichten zum Laufen bringt und Leser bei der Stange hält. Wer mehr als eine Meldung, einen kurzen Bericht oder einen reinen Informationstext verfasst, muss diese visuellen Vorstellungen aus Worten entstehen lassen.
Wenn längere Texte es nicht schaffen, beim Leser das Kopfkino in Gang zu setzen, werden sie schnell langweilig. Oder sie lassen einen kalt, obwohl sie tadellos geschrieben sind, wie Constantin Seibt beobachtet hat: „Man liest sie mit Respekt, aber wie durch eine Plexiglasscheibe hindurch“, schreibt der Schweizer Journalist in seinem Buch „Deadline. Wie man besser schreibt“. Zu den Heilmitteln, die Seibt für lebendigere, lesenswertere Texte empfiehlt, gehören Zitate, Pointen, Anekdoten und Variationen von Satzlänge bis Rhythmus.
Und ähnlich wie andere Schreibratgeber lenkt Seibt die Aufmerksamkeit auf Schnitte und Perspektivwechsel, wie man sie aus bild- oder videojournalistischen Arbeiten kennt. Ein weiter Blick auf die Totale, um etwas einzuordnen – der Panoramaschwenk vom vollautomatisierten Großbetrieb der Milchwirtschaft zu sechs Kühen, die in einem Schwarzwaldtal abends zum Hof getrieben werden. Das Ranzoomen auf Details: der wiegende Schritt der Tiere, ihr drängendes Rufen wegen der prallen Euter, das Eintauchen in den Stallgeruch aus Holz, Dung, Stroh und einer süßlichen Milchnote.
Genau: Tupfer von Geräuschen, Gerüchen und Gefühlen kitzeln die Vorstellungskraft oft noch besser als zweidimensionale Bilder, seien sie statisch oder bewegt. Auf jeden Fall wird die dargestellte Welt desto plastischer erscheinen, je mehr Sinne angesprochen werden.
Kleine Wahnehmungsschule
So wie Bildjournalisten sich von der Arbeit der Kollegen inspirieren lassen (siehe „Starke Momente“), finden auch Schreibende Anregungen in den Texten anderer. Und sie können das Einschalten der Sinnesorgane in einer ruhigen Minute trainieren: Im Wartezimmer beim Arzt mal das Sehen ausblenden und nur lauschen, selbst wenn alle Anwesenden nur schweigend in Illustrierten blättern. Eingequetscht in der S-Bahn nach allem forschen, was man haptisch und seelisch fühlt. Die Nase nicht nur für Düfte öffnen, sondern auch für den Gestank der Mülltonnen im Sommer. Selbst beim Gucken kann man sich zugucken: Farben und Formen, Gesichter und Körper, eingefrorene Einzelbilder oder lebhafte Szenen. Was sehe ich und was übersehe ich gerne? Bleibt noch, die passenden Worte für das zu finden, was die kleine Wahrnehmungsschule mir enthüllt.
Es gibt auch einfachere Mittel, um Bilder über die innere Leinwand des Lesers laufen zu lassen. Schon viele einfache Redewendungen haben eine visuelle Komponente: die neuen Besen, die gehobelten Späne, der Tropfen im Fass. Allerdings werden sie kaum noch in ihrer ursprünglichen, bildhaften Bedeutung wahrgenommen. Damit sie wieder lebendig werden, muss man damit spielen, sie mit assoziativer Kreativität variieren, vielleicht auch mal auf den Kopf stellen.
Storytelling
Derzeit ist Storytelling in aller Munde. Man hat den Eindruck, als ob es sich um eine Erfindung aus jüngster Zeit handelt. Dabei bedeutet es nichts anderes, als eine Geschichte zu erzählen. Geschichten berühren, vermitteln Fakten und transportieren Emotionen. Im Mittelpunkt steht dabei in der Regel eine subjektive Story aus einer besonderen Perspektive, nämlich die einer betroffenen Person.
Storytelling ist keine spezifische journalistische Darstellungsform, sondern kann als Erzählprozess verstanden werden. Am Anfang stehen unzählige Fragen: Was will ich erzählen? Was ist die Kernaussage der Story? Wie werde ich sie publizieren – als Printbeitrag oder online? Welches visuelle Konzept steckt dahinter? Einzelbilder, Fotostrecken, Video-Clips? Das Ganze in Schwarz-Weiß oder Farbe? Welche Sounddateien stehen zur Verfügung?
Multimedial aufbereitete Geschichten bieten noch mehr Möglichkeit zu Emontionalisierung als Printbeiträge. Dazu tragen neben Fotos und Videos auch Audios bei – etwa Stimmen der Interviewpartner und Hintergrundgeräusche. Das Zusammenspiel kann beim Betrachter Gefühle auslösen oder verstärken, lässt ihn tiefer ins Geschehen eintauchen.
Gerade im Web experimentieren Medien und Journalisten derzeit mit neuen Erzählweisen, etwa bei Zeit Online (Das neue Leben in der Stalin Allee) oder bei der Rhein-Zeitung (Arabellion), um nur zwei Beispiele zu nennen. Entwicklungen wie schnelles Internet, die aktuellen Webbrowser und Programmiersprachen eröffnen bisher nicht gekannte Möglichkeiten, Themen visuell interessant umzusetzen – etwa bewegte Hintergrundbilder oder Mouse-Over-Annimationen.
Solche Projekte sind nichts für den schnellen Newsalltag. Denn um Geschichten auf diese Art zu erzählen, ist Konzeptarbeit im Vorfeld erforderlich. Und es braucht ein ausreichendes Budget und Know-how, aber auch Zeit und genug Personal.
Genutzt wird Storytelling heute bei Porträts, in Reportagen, in Dokumentationen über historische Ereignisse oder als Bestandteil von Webspecials. Auch die Unternehmenskommunikation greift gerne darauf zurück, beleuchtet beispielsweise Produktanwendungen oder Produktions- und Entwicklungsprozesse. Oder erzählt auf Social-Media-Plattformen etwas über das Unternehmen. Geschichten nehmen Leser anders ein als reine Fakten.|| Frank Sonnenberg
Und Achtung: Wo fertige Sprachbilder gedankenlos benutzt werden, können sie dem Schreibenden gemeine Fallen stellen: „Die älteste Flaschenpost unter dem Hammer“ titelten Ende Juli zahlreiche Medien. Eigentlich schade um das schöne Fundstück. Man hätte es doch lieber am Stück versteigern sollen.
Überraschende Vergleiche
Abgenutzt sind auch die typischen Journalistenfloskeln: das Bild des Grauens, die Airline-Aktie im ewigen Sink- oder Steigflug. Das ermüdet genauso wie die Standard-Vergleiche („so groß wie zwei Fußballfelder“). Damit ein nützlicher, aber mäßig interessanter Wie-Vergleich mehr hergibt als „Volkshochschule“, empfiehlt Seibt ein paar Minuten des Nachdenkens zu investieren: Denn der Sinn einer solchen sprachlichen Figur sei doch „der Transport von visuellen, gedanklichen oder moralischen Schocks“.
Beispiel gefällig? Als Beschreibung des Schweizer Journalisten und Medienunternehmers Roger Köppel, der mit den Jahren immer schmallippiger geworden sei, schlägt Seibt vor: „Roger Köppels Lippen sind so hart und schmal geworden, sdass man mit ihnen problemlos Fußnägel schneiden könnte.“ Zugegebenermaßen ein Schock, und sicher nicht für jede Sorte Text geeignet.
Trotzdem: Selbst schnelle Alltagstexte vertragen ein bisschen Bilddenken, hier und da einen szenischen Akzent und einen narrativen Schnipsel – so, wie man es ja eigentlich auch mal gelernt hat. Denn was nutzen Name und Rasse des Hunds, mit denen man gängigen Empfehlungen zufolge vom Recherchetermin zurückkommen soll, wenn er später nicht ungeduldig jiepernd neben der Wohnungstür tänzeln darf?||
Corinna Blümel